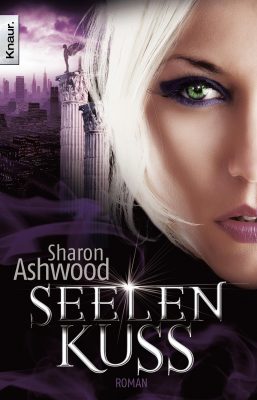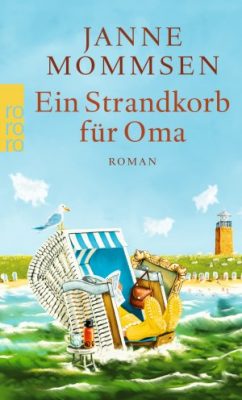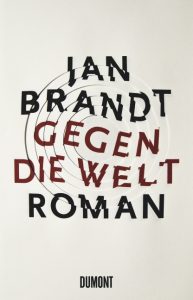 Daniel Kuper scheint ein normaler Junge zu sein, der in einem beschaulichen Dorf namens Jericho aufwächst, dort die Schule besucht, Freundschaften knüpft und wieder löst, sowie ein gewisses Interesse an Mädchen besitzt. Diese Eigenschaften, gepaart mit viel Schabernack und Fantasie im Kopf, macht ihn zu einem gewöhnlichen Teenager. Jedoch ereignen sich im Verlauf der Geschichte merkwürdige Ereignisse: unter anderem das Auftauchen eines Kornkreises, der Selbstmord eines Mitschülers und ganze Häuserreihen beschmiert mit Hakenkreuzen. Als Übeltäter dieser merkwürdigen Geschehnisse wird Daniel ausgemacht, der nun in einen Kampf zwischen sich und seiner Umwelt verwickelt ist.
Daniel Kuper scheint ein normaler Junge zu sein, der in einem beschaulichen Dorf namens Jericho aufwächst, dort die Schule besucht, Freundschaften knüpft und wieder löst, sowie ein gewisses Interesse an Mädchen besitzt. Diese Eigenschaften, gepaart mit viel Schabernack und Fantasie im Kopf, macht ihn zu einem gewöhnlichen Teenager. Jedoch ereignen sich im Verlauf der Geschichte merkwürdige Ereignisse: unter anderem das Auftauchen eines Kornkreises, der Selbstmord eines Mitschülers und ganze Häuserreihen beschmiert mit Hakenkreuzen. Als Übeltäter dieser merkwürdigen Geschehnisse wird Daniel ausgemacht, der nun in einen Kampf zwischen sich und seiner Umwelt verwickelt ist.
Dies ist in groben Zügen der Inhalt von Jan Brandts Debütroman „Gegen die Welt“, und weist schon beim ersten Hören auf eine spannende und fesselnde Geschichte hin. Seine Sprache wirkt von Anfang an sehr einfach, und ermöglicht es dem Leser schnell sich zurecht zu finden. Mit Hilfe der Sprache gelingt es dem Autor, den Leser schon auf den ersten Seiten an den Roman zu binden.

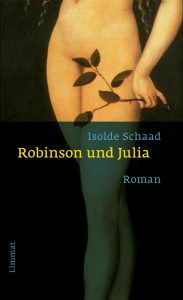 Isolde Schaad macht es dem Leser mit „Robinson und Julia“ wahrlich nicht leicht. Es ist schwer, den „roten Faden“ zu finden, denn scheinbar gibt es keine Zusammenhänge zwischen den kurz gehaltenen Kapiteln. Diese wechseln zwischen den zwei Frauengestalten Eva und Julia. Eva begegnet uns einmal als Eva mit Adam, mit dem sie schon auf gemeinsam verbrachte Jahrtausende als unverheiratetes Paar zurückblicken kann. So kennt sie weder ihr Alter, noch das ihrer Mitmenschen. Der Paradiesapfel und das Feigenblatt verweisen immer wieder auf die Schöpfungsgeschichte. Obwohl Eva mit Adam zusammenlebt, trifft sie aber auch mit Jean-Paul Sartre in Paris zusammen, in dem sie einen Frauenbeglücker sieht. Ebenso begegnet sie Albrecht Dürer und Martin Luther in Wittenberg, was den Leser etwas verwirrt. Zu Eva und Adam ziehen zwei weitere Frauen, Sheila, der die Vertreibung der Palästinenser am Herzen liegt und Claps, mit der Adam ein Verhältnis beginnt. Eva leidet darunter, wenn Adam die Nächte mit Claps verbringt. Doch im weiteren Verlauf fühlt sie sich selbst von der Konkurrentin sexuell angezogen.
Isolde Schaad macht es dem Leser mit „Robinson und Julia“ wahrlich nicht leicht. Es ist schwer, den „roten Faden“ zu finden, denn scheinbar gibt es keine Zusammenhänge zwischen den kurz gehaltenen Kapiteln. Diese wechseln zwischen den zwei Frauengestalten Eva und Julia. Eva begegnet uns einmal als Eva mit Adam, mit dem sie schon auf gemeinsam verbrachte Jahrtausende als unverheiratetes Paar zurückblicken kann. So kennt sie weder ihr Alter, noch das ihrer Mitmenschen. Der Paradiesapfel und das Feigenblatt verweisen immer wieder auf die Schöpfungsgeschichte. Obwohl Eva mit Adam zusammenlebt, trifft sie aber auch mit Jean-Paul Sartre in Paris zusammen, in dem sie einen Frauenbeglücker sieht. Ebenso begegnet sie Albrecht Dürer und Martin Luther in Wittenberg, was den Leser etwas verwirrt. Zu Eva und Adam ziehen zwei weitere Frauen, Sheila, der die Vertreibung der Palästinenser am Herzen liegt und Claps, mit der Adam ein Verhältnis beginnt. Eva leidet darunter, wenn Adam die Nächte mit Claps verbringt. Doch im weiteren Verlauf fühlt sie sich selbst von der Konkurrentin sexuell angezogen.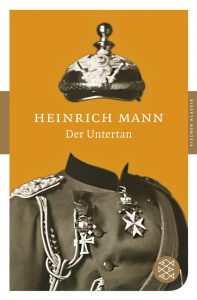 Eine fiktive deutsche Kleinstadt namens Netzig, Ende des 19. Jahrhunderts: Diederich Heßling wächst in der strengen Erziehung der wilhelminischen Epoche auf. Der Vater ist ein patriarchalischer Kleinunternehmer, der zu heftigen Strafen greift, in der Schule wird militärischer Gehorsam gefordert und die Individualität gebrochen. Diese extremen Erziehungsmethoden machen aus Diederich ein Paradebeispiel des autoritären Charakters – gegenüber Vorgesetzten und Höherstehenden zeigt er sich unterwürfig, gegenüber Schwächeren spielt er gnadenlos seine Macht und Dominanz aus. Diederich beginnt ein Chemiestudium in Berlin, wo er sich einer Studentenverbindung anschließt, die sein neues Denken zusätzlich fördert. Zurück in seiner Heimatstadt, übernimmt er die Fabrik des verstorbenen Vaters und schaltet durch Intrigen seine Konkurrenten aus. In fanatischer Verehrung des Kaisers Wilhelm II. steigt er zur wichtigsten Person der Stadt auf.
Eine fiktive deutsche Kleinstadt namens Netzig, Ende des 19. Jahrhunderts: Diederich Heßling wächst in der strengen Erziehung der wilhelminischen Epoche auf. Der Vater ist ein patriarchalischer Kleinunternehmer, der zu heftigen Strafen greift, in der Schule wird militärischer Gehorsam gefordert und die Individualität gebrochen. Diese extremen Erziehungsmethoden machen aus Diederich ein Paradebeispiel des autoritären Charakters – gegenüber Vorgesetzten und Höherstehenden zeigt er sich unterwürfig, gegenüber Schwächeren spielt er gnadenlos seine Macht und Dominanz aus. Diederich beginnt ein Chemiestudium in Berlin, wo er sich einer Studentenverbindung anschließt, die sein neues Denken zusätzlich fördert. Zurück in seiner Heimatstadt, übernimmt er die Fabrik des verstorbenen Vaters und schaltet durch Intrigen seine Konkurrenten aus. In fanatischer Verehrung des Kaisers Wilhelm II. steigt er zur wichtigsten Person der Stadt auf.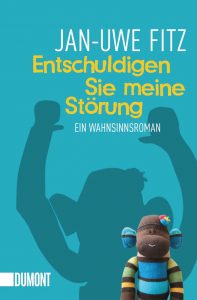 Jan-Uwe Fitz fühlt sich selbst in dem Wahnsinnsroman „Entschuldigen Sie meine Störung“ verfolgt. Einer Gruppe von Bauarbeitern mit Presslufthammer und Betonmischer kann er nicht entkommen. Er hat panische Angst vor Menschen und kann sich nicht länger als zehn Minuten auf einer Party aufhalten, bis er sich davon stiehlt. Auf jede Berührung muss er vorbereitet sein und verliebt sich andererseits sofort in jeden, der ihn berührt. In Selbstgesprächen offenbart er, was bei ihm alles peinlich wirkt, bei einem George Clooney aber voll cool wäre. Man erfährt von ihm Tipps, wie soziale Phobiker ihre Störungen in den Griff bekommen können. Die Kaffeekränzchen bei seinen Nachbarn sind ihm zuwider und seine Eltern hat er seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Die Menschen möchte er umerziehen, damit er sie überhaupt ertragen kann und auf der Suche nach einem Psychiater landet er bei einem Metzger.
Jan-Uwe Fitz fühlt sich selbst in dem Wahnsinnsroman „Entschuldigen Sie meine Störung“ verfolgt. Einer Gruppe von Bauarbeitern mit Presslufthammer und Betonmischer kann er nicht entkommen. Er hat panische Angst vor Menschen und kann sich nicht länger als zehn Minuten auf einer Party aufhalten, bis er sich davon stiehlt. Auf jede Berührung muss er vorbereitet sein und verliebt sich andererseits sofort in jeden, der ihn berührt. In Selbstgesprächen offenbart er, was bei ihm alles peinlich wirkt, bei einem George Clooney aber voll cool wäre. Man erfährt von ihm Tipps, wie soziale Phobiker ihre Störungen in den Griff bekommen können. Die Kaffeekränzchen bei seinen Nachbarn sind ihm zuwider und seine Eltern hat er seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Die Menschen möchte er umerziehen, damit er sie überhaupt ertragen kann und auf der Suche nach einem Psychiater landet er bei einem Metzger. 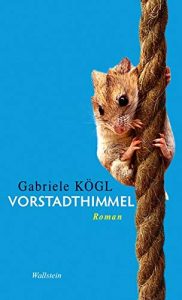 In ihrem Roman „Vorstadthimmel“ erzählt Gabriele Kögl die Geschichte eines Emporkömmlings und einer zeitgeistigen Journalistin, indem sie geschickt die verschiedenen Perspektiven der beiden Protagonisten beleuchtet, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
In ihrem Roman „Vorstadthimmel“ erzählt Gabriele Kögl die Geschichte eines Emporkömmlings und einer zeitgeistigen Journalistin, indem sie geschickt die verschiedenen Perspektiven der beiden Protagonisten beleuchtet, die unterschiedlicher nicht sein könnten.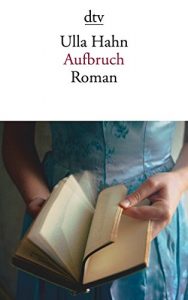 Es ist die Amtszeit von John F. Kennedy und vier „Pilzköpfe“ bringen die Mädchen um den Verstand. Das Buch „Aufbruch“ von Ulla Hahn versetzt uns mit Hildegard Palm, kurz Hilla genannt, in diese Zeit. Hilla wohnt mit ihrer Familie in Dondorf, einem kleinen Örtchen am Rhein und besucht das Aufbaugymnasium. Was für eine aus einer Proletenfamilie schon ungewöhnlich ist. Fast täglich trifft sie sich mit dem aus besserem Hause stammenden Godehard, der ihr Geschenke macht. Darunter sogar einen Ring, mit dem er ernste Absichten bekundet. Dabei denkt Hilla noch gar nicht an eine feste Bindung, sondern hat nur ihr Ziel Abitur und Studium vor Augen. So „kniefällig“ wie ihre Mutter will sie nicht werden. Als sie jedoch erfährt, dass sie nur als Ersatz für eine Andere herhalten muss, ist sie froh, sich ihr „Kapital“, wie die Mutter immer gemahnt hat, bewahrt zu haben. Und ihr Zuhause ein Loch genannt zu haben, nein, das hätte Godehard nicht sagen dürfen.
Es ist die Amtszeit von John F. Kennedy und vier „Pilzköpfe“ bringen die Mädchen um den Verstand. Das Buch „Aufbruch“ von Ulla Hahn versetzt uns mit Hildegard Palm, kurz Hilla genannt, in diese Zeit. Hilla wohnt mit ihrer Familie in Dondorf, einem kleinen Örtchen am Rhein und besucht das Aufbaugymnasium. Was für eine aus einer Proletenfamilie schon ungewöhnlich ist. Fast täglich trifft sie sich mit dem aus besserem Hause stammenden Godehard, der ihr Geschenke macht. Darunter sogar einen Ring, mit dem er ernste Absichten bekundet. Dabei denkt Hilla noch gar nicht an eine feste Bindung, sondern hat nur ihr Ziel Abitur und Studium vor Augen. So „kniefällig“ wie ihre Mutter will sie nicht werden. Als sie jedoch erfährt, dass sie nur als Ersatz für eine Andere herhalten muss, ist sie froh, sich ihr „Kapital“, wie die Mutter immer gemahnt hat, bewahrt zu haben. Und ihr Zuhause ein Loch genannt zu haben, nein, das hätte Godehard nicht sagen dürfen.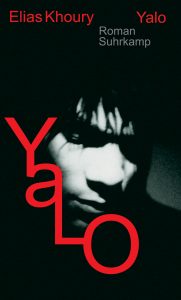 In Elias Khourys Roman „Yalo“ wird die Titelfigur im Gefängnis von Beirut einem Verhör unterzogen. Der Ermittler erwartet von ihm, dass er sich seiner Vergehen für schuldig bekennt. Schîrîn Raad hätte ihn wegen Vergewaltigung angezeigt. Aber das sind doch alles gemeine Unterstellungen! Sie hat doch nach seinen Umarmungen geschmachtet! Er hat sie doch geliebt, sich in ihre Zartheit verliebt. Die Liebe zu ihr schnitt ihm die Luft ab, er wollte sie heiraten! Und die Sterne konnte er nur bei ihr sehen! Warum glaubt man ihm nicht und quält ihn dafür? Er wird geschlagen, getreten, aufs Übelste gefoltert. Dann soll er alles aufschreiben, seine ganze Lebensgeschichte und bloß bei der Wahrheit bleiben!
In Elias Khourys Roman „Yalo“ wird die Titelfigur im Gefängnis von Beirut einem Verhör unterzogen. Der Ermittler erwartet von ihm, dass er sich seiner Vergehen für schuldig bekennt. Schîrîn Raad hätte ihn wegen Vergewaltigung angezeigt. Aber das sind doch alles gemeine Unterstellungen! Sie hat doch nach seinen Umarmungen geschmachtet! Er hat sie doch geliebt, sich in ihre Zartheit verliebt. Die Liebe zu ihr schnitt ihm die Luft ab, er wollte sie heiraten! Und die Sterne konnte er nur bei ihr sehen! Warum glaubt man ihm nicht und quält ihn dafür? Er wird geschlagen, getreten, aufs Übelste gefoltert. Dann soll er alles aufschreiben, seine ganze Lebensgeschichte und bloß bei der Wahrheit bleiben! 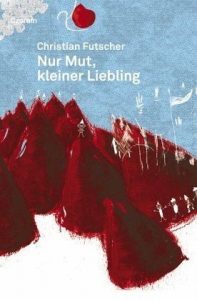 In seinem Roman „Nur Mut, kleiner Liebling“ lässt der Autor Christian Futscher seinen Protagonisten, den 49-jährigen Christian, seinen Gedanken nachhängen. Der Wiener hält sich wiederholt in Venedig auf, immer in der gleichen Wohnung, um an einem neuen Buch zu schreiben. Wenn er nicht daran schreibt oder in einem der vielen Bücher liest, führt er ein Tagebuch und schreibt seine Erinnerungen darin nieder.
In seinem Roman „Nur Mut, kleiner Liebling“ lässt der Autor Christian Futscher seinen Protagonisten, den 49-jährigen Christian, seinen Gedanken nachhängen. Der Wiener hält sich wiederholt in Venedig auf, immer in der gleichen Wohnung, um an einem neuen Buch zu schreiben. Wenn er nicht daran schreibt oder in einem der vielen Bücher liest, führt er ein Tagebuch und schreibt seine Erinnerungen darin nieder.