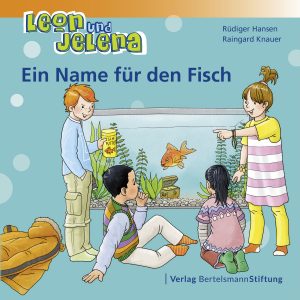 Leon besucht eine Kindertagesstätte und kennt bereits die Fische im Aquarium, die Flitzi und Flatzi heißen. Aber weil seine Erzieherin Anja einen neuen Fisch hinzugegeben hat, kann er seine Neugier kaum bremsen und rennt zum Aquarium. Adil und Esma, zwei aus Syrien stammende neue Kinder in seiner Gruppe, setzen sich zu Badu, Leon und seiner Freundin Jelena zum Malen an den Tisch. Als Leon die Fische füttert, sehen sie aufmerksam zu. Aber noch hat der Fisch keinen Namen wie die anderen beiden. Deshalb bittet Anja die Kinder in der Kinderkonferenz, für den neuen Fisch einen Namen auszusuchen.
Leon besucht eine Kindertagesstätte und kennt bereits die Fische im Aquarium, die Flitzi und Flatzi heißen. Aber weil seine Erzieherin Anja einen neuen Fisch hinzugegeben hat, kann er seine Neugier kaum bremsen und rennt zum Aquarium. Adil und Esma, zwei aus Syrien stammende neue Kinder in seiner Gruppe, setzen sich zu Badu, Leon und seiner Freundin Jelena zum Malen an den Tisch. Als Leon die Fische füttert, sehen sie aufmerksam zu. Aber noch hat der Fisch keinen Namen wie die anderen beiden. Deshalb bittet Anja die Kinder in der Kinderkonferenz, für den neuen Fisch einen Namen auszusuchen.
Es mangelt den Kindern nicht an Ideen, wie der Fisch heißen könnte, doch was dem einen gefällt, mag der andere nicht. Als Adil, der kein Wort Deutsch kann, Samak ruft, wollen alle wissen, was das bedeutet. Von einer Übersetzerin erfahren sie, dass Samak das arabische Wort für Fisch ist. Spontan sind die Kinder von dem Wort begeistert und schlagen als Namen für den Fisch Samaki vor, zumal Adil und Esma damit an ihre Heimat erinnert werden.
weiterlesenLeon und Jelena – Ein Name für den Fisch von Rüdiger Hansen und Raingard Knauer

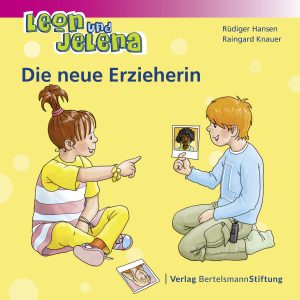 Im Kindergarten erklären die Erzieherinnen Anja und Sonja den Kindern während einer Kinderkonferenz, dass sie bald eine neue Erzieherin einstellen müssen. Der Grund ist schon offensichtlich, denn Sonja erwartet ein Baby. Für die Stellenanzeige bitten Anja und Sonja die Kinder um Vorschläge, was die neue Erzieherin können sollte. Auf die Ausschreibung melden sich zwei Frauen: Britta Klein und Amaril Jones. Beide haben ihrer Bewerbung Fotos hinzugefügt, die sich die Kinder anschauen. Jelena, Leon, Badu und Esma haben sich bereit erklärt, die beiden durch den Kindergarten zu führen, um ihnen alles zu zeigen. Nachdem sich Britta Klein als erste vorgestellt hat, sind alle neugierig auf Amaril Jones. Am Ende stimmen die Kinder ab und müssen sich für eine der beiden entscheiden, da nur eine die neue Erzieherin werden kann.
Im Kindergarten erklären die Erzieherinnen Anja und Sonja den Kindern während einer Kinderkonferenz, dass sie bald eine neue Erzieherin einstellen müssen. Der Grund ist schon offensichtlich, denn Sonja erwartet ein Baby. Für die Stellenanzeige bitten Anja und Sonja die Kinder um Vorschläge, was die neue Erzieherin können sollte. Auf die Ausschreibung melden sich zwei Frauen: Britta Klein und Amaril Jones. Beide haben ihrer Bewerbung Fotos hinzugefügt, die sich die Kinder anschauen. Jelena, Leon, Badu und Esma haben sich bereit erklärt, die beiden durch den Kindergarten zu führen, um ihnen alles zu zeigen. Nachdem sich Britta Klein als erste vorgestellt hat, sind alle neugierig auf Amaril Jones. Am Ende stimmen die Kinder ab und müssen sich für eine der beiden entscheiden, da nur eine die neue Erzieherin werden kann.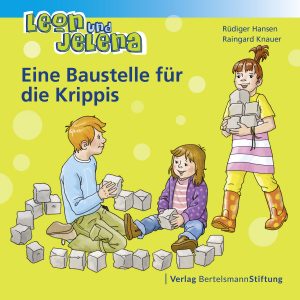 In einem Kindergarten ist die Krippengruppe für unter Dreijährige neu eingerichtet worden, weshalb auch das Grundstück im Garten vergrößert werden muss. Doch stellt sich für die Erzieherin Dilara die Frage, mit welchen Sachen dort sowohl ihre Kleinen, wie auch die älteren Kinder der anderen Gruppe spielen können. Als Badu hört, dass Dilara die Krippis, wie die Krippenkinder genannt werden, schon mitentscheiden lassen will, wundert er sich. Wie können die etwas entscheiden, wenn einige sogar noch gefüttert werde müssen? Mit seinem Freund Leon begleitet er die Gruppe zu einem Spielplatz. Zum Erstaunen aller interessieren sich die Kleinen am meisten für einen Haufen bunter Kieselsteine, die sie dort entdeckt haben.
In einem Kindergarten ist die Krippengruppe für unter Dreijährige neu eingerichtet worden, weshalb auch das Grundstück im Garten vergrößert werden muss. Doch stellt sich für die Erzieherin Dilara die Frage, mit welchen Sachen dort sowohl ihre Kleinen, wie auch die älteren Kinder der anderen Gruppe spielen können. Als Badu hört, dass Dilara die Krippis, wie die Krippenkinder genannt werden, schon mitentscheiden lassen will, wundert er sich. Wie können die etwas entscheiden, wenn einige sogar noch gefüttert werde müssen? Mit seinem Freund Leon begleitet er die Gruppe zu einem Spielplatz. Zum Erstaunen aller interessieren sich die Kleinen am meisten für einen Haufen bunter Kieselsteine, die sie dort entdeckt haben.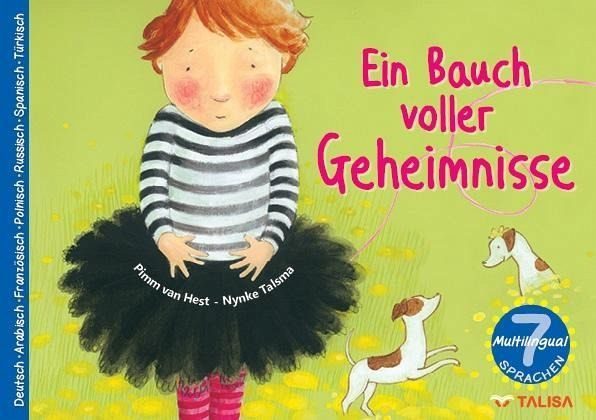
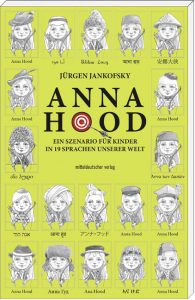 Anna ist über das, was sie gerade in den Nachrichten sieht, entsetzt: Ein Flüchtling trägt ein totes Kind auf dem Arm, das er aus dem Meer kommend auf einem Strand ablegt, während ihm Touristen dabei zusehen. Sie hört den Spendenaufruf des Nachrichtensprechers und entschließt sich spontan, auf das Geld zu verzichten, das sie von ihren Großeltern für den nächsten Urlaub bekommen hat. Doch damit nicht genug. Anna sammelt auch Geld von Verwandten und Bekannten und sogar von Freunden auf der Straße.
Anna ist über das, was sie gerade in den Nachrichten sieht, entsetzt: Ein Flüchtling trägt ein totes Kind auf dem Arm, das er aus dem Meer kommend auf einem Strand ablegt, während ihm Touristen dabei zusehen. Sie hört den Spendenaufruf des Nachrichtensprechers und entschließt sich spontan, auf das Geld zu verzichten, das sie von ihren Großeltern für den nächsten Urlaub bekommen hat. Doch damit nicht genug. Anna sammelt auch Geld von Verwandten und Bekannten und sogar von Freunden auf der Straße.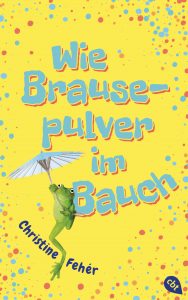 Frieda und Anselm besuchen dieselbe Schule. Anselm, der von allen nur Amsel gerufen wird, gilt als Außenseiter in der Klasse und verbringt als Nerd die Nachmittage am liebsten vor seinem Computer. Mathematik bereitet ihm im Gegensatz zu Frieda keine Probleme, die in dem ihr verhassten Fach sogar Nachhilfe von einer älteren Schülerin benötigt. Dafür ist sie in Musik und Sport die Bessere.
Frieda und Anselm besuchen dieselbe Schule. Anselm, der von allen nur Amsel gerufen wird, gilt als Außenseiter in der Klasse und verbringt als Nerd die Nachmittage am liebsten vor seinem Computer. Mathematik bereitet ihm im Gegensatz zu Frieda keine Probleme, die in dem ihr verhassten Fach sogar Nachhilfe von einer älteren Schülerin benötigt. Dafür ist sie in Musik und Sport die Bessere. 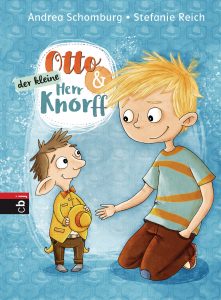 Auf Knorffin, einer Insel mitten im Meer, leben die Knorffe. Sie lieben die Unordnung und räumen nie auf. Nur Knobelius Knorff ist ganz anders und fühlt sich bei den Knorffen nicht wohl. Er weiß, dass man durch die Dunkelschlucht zu den Menschen gelangen kann, die für ihre Ordnung und Sauberkeit bekannt sind. Um zu ihnen zu kommen, stürzt er sich in die Schlucht und landet im Kinderzimmer von Otto. Doch dort angekommen, ist Knobelius entsetzt: Nicht nur in Ottos Zimmer, wo stinkige Socken und dreckige T-Shirts auf dem Boden herumliegen, ist es so unordentlich wie auf Knorffin. Auch die Eltern und Ottos Schwester halten nichts vom Aufräumen.
Auf Knorffin, einer Insel mitten im Meer, leben die Knorffe. Sie lieben die Unordnung und räumen nie auf. Nur Knobelius Knorff ist ganz anders und fühlt sich bei den Knorffen nicht wohl. Er weiß, dass man durch die Dunkelschlucht zu den Menschen gelangen kann, die für ihre Ordnung und Sauberkeit bekannt sind. Um zu ihnen zu kommen, stürzt er sich in die Schlucht und landet im Kinderzimmer von Otto. Doch dort angekommen, ist Knobelius entsetzt: Nicht nur in Ottos Zimmer, wo stinkige Socken und dreckige T-Shirts auf dem Boden herumliegen, ist es so unordentlich wie auf Knorffin. Auch die Eltern und Ottos Schwester halten nichts vom Aufräumen.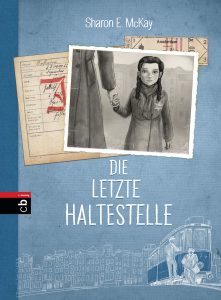 Im Kriegsjahr 1942 wird es für die Juden in Amsterdam, das die Deutschen besetzt haben, immer gefährlicher. So auch für eine jüdische Mutter mit ihrer sechsjährigen Tochter Beatrix in dem Roman „Die letzte Haltestelle“. Als sie auf dem Weg zu einer Fluchthelferin sind, werden sie in einer Straßenbahn von deutschen Soldaten kontrolliert. Die Mutter wird abgeführt, während der Kontrolleur Lars das Kind kurzerhand als seine Nichte ausgibt. Doch wie sein Bruder Hans, der Fahrer der Straßenbahn, war er nie verheiratet und hat keine Ahnung, wie man mit einem Kind umgeht.
Im Kriegsjahr 1942 wird es für die Juden in Amsterdam, das die Deutschen besetzt haben, immer gefährlicher. So auch für eine jüdische Mutter mit ihrer sechsjährigen Tochter Beatrix in dem Roman „Die letzte Haltestelle“. Als sie auf dem Weg zu einer Fluchthelferin sind, werden sie in einer Straßenbahn von deutschen Soldaten kontrolliert. Die Mutter wird abgeführt, während der Kontrolleur Lars das Kind kurzerhand als seine Nichte ausgibt. Doch wie sein Bruder Hans, der Fahrer der Straßenbahn, war er nie verheiratet und hat keine Ahnung, wie man mit einem Kind umgeht.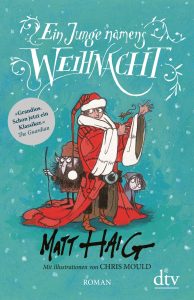 In Finnland lebt der elfjährige Nikolas mit seinem Vater Joel, einem Holzfäller, in ärmlichsten Verhältnissen. In ihrem Haus gibt es nur ein einziges Zimmer und ein Loch hinter ihrem Haus dient ihnen als Klo. Nikolas hat keine Geschwister und sein einziger Besitz sind ein Schlitten und eine Steckrübenpuppe, die er von seiner verstorbenen Mutter bekommen hat. Da er am Weihnachtstag geboren wurde, nennt ihn sein Vater auch Weihnacht.
In Finnland lebt der elfjährige Nikolas mit seinem Vater Joel, einem Holzfäller, in ärmlichsten Verhältnissen. In ihrem Haus gibt es nur ein einziges Zimmer und ein Loch hinter ihrem Haus dient ihnen als Klo. Nikolas hat keine Geschwister und sein einziger Besitz sind ein Schlitten und eine Steckrübenpuppe, die er von seiner verstorbenen Mutter bekommen hat. Da er am Weihnachtstag geboren wurde, nennt ihn sein Vater auch Weihnacht.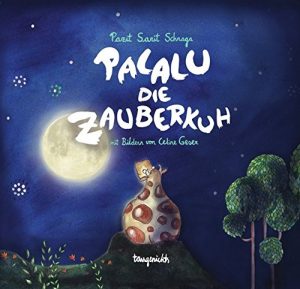 „Palalu die Zauberkuh“ und ihre Tochter Sue begegnen auf einer bunten Blumenwiese dem Mädchen Anneliese, die mit den Schmetterlingen gespielt hat, bis sie außer Puste geraten ist. Anneliese ist stolz auf ihre glänzenden, roten Lackschuhe, während Palalu die braunen Punkte auf ihrem Körper mag. Plötzlich stellt das Mädchen fest, dass es sich beim Spiel verlaufen hat und nicht mehr nach Hause findet. Der Tag neigt sich dem Ende und es wird immer dunkler. In der Nacht, so verkündet ihr die Kuh, kann sie von ihrer Mutter nicht mehr gefunden werden.
„Palalu die Zauberkuh“ und ihre Tochter Sue begegnen auf einer bunten Blumenwiese dem Mädchen Anneliese, die mit den Schmetterlingen gespielt hat, bis sie außer Puste geraten ist. Anneliese ist stolz auf ihre glänzenden, roten Lackschuhe, während Palalu die braunen Punkte auf ihrem Körper mag. Plötzlich stellt das Mädchen fest, dass es sich beim Spiel verlaufen hat und nicht mehr nach Hause findet. Der Tag neigt sich dem Ende und es wird immer dunkler. In der Nacht, so verkündet ihr die Kuh, kann sie von ihrer Mutter nicht mehr gefunden werden.