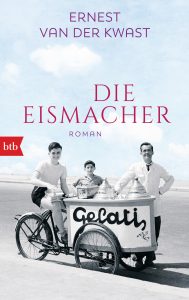 Giovanni gehört einer traditionsreichen Familie von Eismachern an. Schon sein Urgroßvater Giuseppe Talamini ist in Venas di Cadore in den Dolomiten aufgewachsen und war Zeitzeuge beim Durchbruch des Gotthard-Tunnels im Jahr 1880. Von einem Aufenthalt in Wien brachte er sich eine Eismaschine mit, was bei seinem Vater erwartungsgemäß auf Unverständnis stieß. Trotzdem kletterte er bis zum Gletscher auf den Antelao, um von dort gefrorenes Eis für seine ersten Experimente zur Herstellung von Sahneeis und Sorbet zu gewinnen, womit er den Grundstock für die nachkommenden Generationen legte.
Giovanni gehört einer traditionsreichen Familie von Eismachern an. Schon sein Urgroßvater Giuseppe Talamini ist in Venas di Cadore in den Dolomiten aufgewachsen und war Zeitzeuge beim Durchbruch des Gotthard-Tunnels im Jahr 1880. Von einem Aufenthalt in Wien brachte er sich eine Eismaschine mit, was bei seinem Vater erwartungsgemäß auf Unverständnis stieß. Trotzdem kletterte er bis zum Gletscher auf den Antelao, um von dort gefrorenes Eis für seine ersten Experimente zur Herstellung von Sahneeis und Sorbet zu gewinnen, womit er den Grundstock für die nachkommenden Generationen legte.
Giovanni ist allerdings der erste Talamini, der mit dieser Familientradition bricht: Er wendet sich lieber der Poesie zu, wird Direktor des World Poetry Festivals und tingelt in der ganzen Welt von Festival zu Festival. Seiner Familie missfällt das gewaltig, denn sein Vater und seine Mutter arbeiten trotz ihres hohen Alters immer noch acht Monate lang in dem Eiscafé Venezia in Rotterdam, ohne sich auch nur einen Tag Pause zu gönnen. Seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Luca und dessen Ehefrau Sophia ergeht es nicht besser, denn auch ihnen bleiben nur die Wintermonate in den Dolomiten zur Erholung.

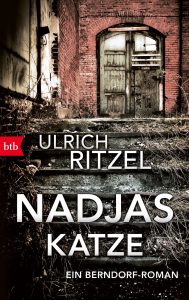 Nadja Schwertfeger erwirbt von einem Antiquar das Heft „Die Nachtwache des Soldaten Pietzsch“ des Autors Paul Anderweg, in dem es um Ereignisse geht, die sich in der Nacht vom 19. auf den 20. April 1945 in einem Dorf zugetragen haben. Wiederholt ist von einem weiblichen Flüchtling und ihrem fünfjährigen Sohn die Rede, doch interessiert sich Nadja vor allem für die vom Autor beschriebene Stoffkatze, die mit „Nadjas Katze“ identisch ist. Sie selbst wurde als Säugling im Februar 1946 vom Ehepaar Schwertfeger adoptiert und weiß lediglich, dass ihre leibliche Mutter eine unbekannte Polin oder Russin gewesen sein soll. Über die Stoffkatze hofft sie, mehr über ihre Mutter und ihr Schicksal zu erfahren, wozu sie den Ort ausfindig machen muss, in der eine gewisse Elfie Stoffkatzen genäht haben soll.
Nadja Schwertfeger erwirbt von einem Antiquar das Heft „Die Nachtwache des Soldaten Pietzsch“ des Autors Paul Anderweg, in dem es um Ereignisse geht, die sich in der Nacht vom 19. auf den 20. April 1945 in einem Dorf zugetragen haben. Wiederholt ist von einem weiblichen Flüchtling und ihrem fünfjährigen Sohn die Rede, doch interessiert sich Nadja vor allem für die vom Autor beschriebene Stoffkatze, die mit „Nadjas Katze“ identisch ist. Sie selbst wurde als Säugling im Februar 1946 vom Ehepaar Schwertfeger adoptiert und weiß lediglich, dass ihre leibliche Mutter eine unbekannte Polin oder Russin gewesen sein soll. Über die Stoffkatze hofft sie, mehr über ihre Mutter und ihr Schicksal zu erfahren, wozu sie den Ort ausfindig machen muss, in der eine gewisse Elfie Stoffkatzen genäht haben soll.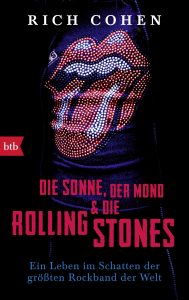 Rich Cohen arbeitete seit 1993 als freier Mitarbeiter bei dem Musikmagazin Rolling Stone und erhielt ein Jahr später, mit erst sechsundzwanzig Jahren, den Auftrag, für die Zeitschrift über die US-Tour der Rolling Stones zu schreiben. Wie kaum einem anderen Menschen gab ihm das die Möglichkeit, hinter die Kulissen und in die Privatsphäre der Bandmitglieder zu schauen, die auch später noch für seine Fragen zur Verfügung standen, was die Entstehung seines Buches „Die Sonne, der Mond & die Rolling Stones“ erst möglich machte.
Rich Cohen arbeitete seit 1993 als freier Mitarbeiter bei dem Musikmagazin Rolling Stone und erhielt ein Jahr später, mit erst sechsundzwanzig Jahren, den Auftrag, für die Zeitschrift über die US-Tour der Rolling Stones zu schreiben. Wie kaum einem anderen Menschen gab ihm das die Möglichkeit, hinter die Kulissen und in die Privatsphäre der Bandmitglieder zu schauen, die auch später noch für seine Fragen zur Verfügung standen, was die Entstehung seines Buches „Die Sonne, der Mond & die Rolling Stones“ erst möglich machte. 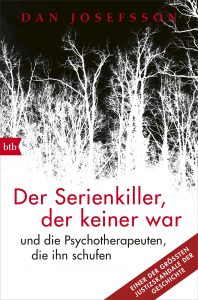 Mitunter ist es schwierig, einen Täter zu einem Geständnis zu bewegen. Ganz anders verhält es sich jedoch in dem Sachbuch „Der Serienkiller, der keiner war“, in dem Dan Josefsson der Frage nachgeht, wie es möglich ist, dass ein Mensch 39 Morde gesteht, aber keinen einzigen davon begangen hat. Als der Autor zur Beerdigung seines Freundes Hannes Råstam fährt, der 2008 den größten Justizskandal des Jahrhunderts um den Fall Sture Bergwall aufdeckte, bittet ihn kurz darauf der Bruder des angeblichen Killers, bisher noch unerwähnte Details in einem Buch zu veröffentlichen. Um dieser Bitte nachzukommen und die Arbeit seines verstorbenen Freundes fortzusetzen, beginnt Dan Josefsson mit der Recherche:
Mitunter ist es schwierig, einen Täter zu einem Geständnis zu bewegen. Ganz anders verhält es sich jedoch in dem Sachbuch „Der Serienkiller, der keiner war“, in dem Dan Josefsson der Frage nachgeht, wie es möglich ist, dass ein Mensch 39 Morde gesteht, aber keinen einzigen davon begangen hat. Als der Autor zur Beerdigung seines Freundes Hannes Råstam fährt, der 2008 den größten Justizskandal des Jahrhunderts um den Fall Sture Bergwall aufdeckte, bittet ihn kurz darauf der Bruder des angeblichen Killers, bisher noch unerwähnte Details in einem Buch zu veröffentlichen. Um dieser Bitte nachzukommen und die Arbeit seines verstorbenen Freundes fortzusetzen, beginnt Dan Josefsson mit der Recherche: 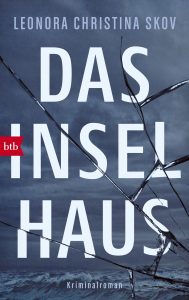 Sieben dänische Künstler und Wissenschaftler haben eine Einladung aufgrund ihrer „herausragenden Leistungen zur Freude Dänemarks“ für einen vierwöchigen Aufenthalt auf einer Insel erhalten. Zu diesem Zweck versammeln sich Robin, Kevin, Joachim, Anne, Sofie, Greta und Poul am Kai von Esbjerg, von wo aus sie mit einer Fähre nach Stormø übersetzen. Obwohl niemand von ihnen den Wohltäter kennt und keiner je von dieser Insel gehört hat, sieht jeder für sich eine Chance in dem Angebot, die er nutzen will.
Sieben dänische Künstler und Wissenschaftler haben eine Einladung aufgrund ihrer „herausragenden Leistungen zur Freude Dänemarks“ für einen vierwöchigen Aufenthalt auf einer Insel erhalten. Zu diesem Zweck versammeln sich Robin, Kevin, Joachim, Anne, Sofie, Greta und Poul am Kai von Esbjerg, von wo aus sie mit einer Fähre nach Stormø übersetzen. Obwohl niemand von ihnen den Wohltäter kennt und keiner je von dieser Insel gehört hat, sieht jeder für sich eine Chance in dem Angebot, die er nutzen will. 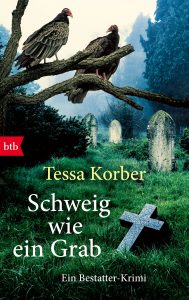 Einem Kriminalbeamten ist es nicht möglich, sich wie ein Bestatter in unverfänglichem Plauderton mit Angehörigen eines Mordopfers auszutauschen. Denn wer weiß schon, wo die Verdächtigen zu suchen sind? In der Bestatter-Krimi-Reihe von Tessa Korber entwickelt Viktor Anders bei Leichenfunden stets detektivischen Spürsinn, wie auch in dem Kriminalroman „Schweig wie ein Grab“. Nach dem Ableben einer Nonne gehört es zu Viktors Aufgaben, den Sarg mit der Toten auf dem Gottesacker des Klosters Trubenbronn beizusetzen. Bei der nächtlichen Bestattung ist üblicherweise keine andere Klosterbewohnerin zugegen. Als Viktor mit seinem autistischen Cousin Tobias dieser Pflicht nachkommen will, entdeckt der einen noch warmen Toten auf dem Acker.
Einem Kriminalbeamten ist es nicht möglich, sich wie ein Bestatter in unverfänglichem Plauderton mit Angehörigen eines Mordopfers auszutauschen. Denn wer weiß schon, wo die Verdächtigen zu suchen sind? In der Bestatter-Krimi-Reihe von Tessa Korber entwickelt Viktor Anders bei Leichenfunden stets detektivischen Spürsinn, wie auch in dem Kriminalroman „Schweig wie ein Grab“. Nach dem Ableben einer Nonne gehört es zu Viktors Aufgaben, den Sarg mit der Toten auf dem Gottesacker des Klosters Trubenbronn beizusetzen. Bei der nächtlichen Bestattung ist üblicherweise keine andere Klosterbewohnerin zugegen. Als Viktor mit seinem autistischen Cousin Tobias dieser Pflicht nachkommen will, entdeckt der einen noch warmen Toten auf dem Acker.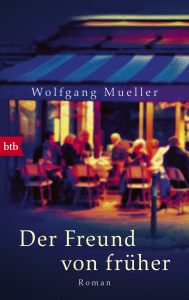 In Berlin trifft Oscar Heym zufällig in einem Café seinen früheren Freund Albert, der als Schauspieler durch eine Werbekampagne Ruhm erlangt hat. Bis vor fünf Jahren Oscar mit seiner Freundin Clara nach Spandau verzogen ist, haben die beiden sich eine Dachgeschosswohnung geteilt, in der sie sich treffen und ihr Wiedersehen feiern wollen. Doch als Oscar seinen Freund dort besuchen will, wird ihm nicht geöffnet. Josefine, eine ehemalige Geliebte von Albert, hat noch einen Schlüssel, und gemeinsam mit ihr betritt Oscar die Wohnung, wo Albert tot auf dem Boden liegt. Der herbeigerufene Notarzt lässt Albert in die Pathologie überführen.
In Berlin trifft Oscar Heym zufällig in einem Café seinen früheren Freund Albert, der als Schauspieler durch eine Werbekampagne Ruhm erlangt hat. Bis vor fünf Jahren Oscar mit seiner Freundin Clara nach Spandau verzogen ist, haben die beiden sich eine Dachgeschosswohnung geteilt, in der sie sich treffen und ihr Wiedersehen feiern wollen. Doch als Oscar seinen Freund dort besuchen will, wird ihm nicht geöffnet. Josefine, eine ehemalige Geliebte von Albert, hat noch einen Schlüssel, und gemeinsam mit ihr betritt Oscar die Wohnung, wo Albert tot auf dem Boden liegt. Der herbeigerufene Notarzt lässt Albert in die Pathologie überführen. 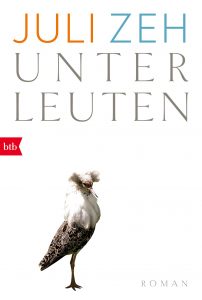 Das brandenburgische Dorf Unterleuten hat weder Geschäfte, noch einen Bahnhof und ist nicht einmal an das Kanalisationsnetz angeschlossen. Wie in früheren Zeiten werden Dienstleistungen mit einem Tauschgeschäft abgegolten. Der ehemalige Soziologieprofessor Gerhard Fließ und Ehefrau Jule sind zugezogen und freuen sich über ihren Nachwuchs. Er arbeitet als Umweltaktivist beim Vogelschutzbund und will mit allen Mitteln verhindern, dass Linda, die mit ihrem Lebensgefährten Frederik ebenfalls neu im Dorf ist, ihre Nebengebäude zu Stallungen für ihr Pferd umbaut, da das Land zum Vogelschutzreservat gehört. Daneben leidet das Ehepaar Fließ unter dem Gestank, den ihr Nachbar Bodo Schaller durch das Verbrennen alter Autoreifen erzeugt.
Das brandenburgische Dorf Unterleuten hat weder Geschäfte, noch einen Bahnhof und ist nicht einmal an das Kanalisationsnetz angeschlossen. Wie in früheren Zeiten werden Dienstleistungen mit einem Tauschgeschäft abgegolten. Der ehemalige Soziologieprofessor Gerhard Fließ und Ehefrau Jule sind zugezogen und freuen sich über ihren Nachwuchs. Er arbeitet als Umweltaktivist beim Vogelschutzbund und will mit allen Mitteln verhindern, dass Linda, die mit ihrem Lebensgefährten Frederik ebenfalls neu im Dorf ist, ihre Nebengebäude zu Stallungen für ihr Pferd umbaut, da das Land zum Vogelschutzreservat gehört. Daneben leidet das Ehepaar Fließ unter dem Gestank, den ihr Nachbar Bodo Schaller durch das Verbrennen alter Autoreifen erzeugt. 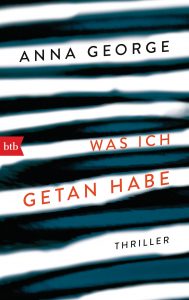 Rechtsanwalt David Forrester lebt in einem kleinen Vorort von Melbourne und ist in zweiter Ehe mit Elle Nolan verheiratet, die ebenfalls Anwältin ist, inzwischen jedoch Drehbücher schreibt. Nachdem sie sich von ihm getrennt hat, geraten die Eheleute bei einem Wiedersehen in eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf David seine Frau tötet. Er spricht darauf seine Aussage auf ein Diktiergerät und fährt zu Reginald, einem Kronanwalt und engstem Freund seines Vaters. Ihm beichtet er, dass Elle vor zwei Monaten die Trennung wollte, er bei seinem Besuch die Selbstbeherrschung verlor und sie mit seinen Händen erwürgt hat. Doch dem Rat von Reginald will David nicht folgen und er irrt deshalb so lange umher, bis er sich entschließt, zur Wohnung von Elle zurückzukehren.
Rechtsanwalt David Forrester lebt in einem kleinen Vorort von Melbourne und ist in zweiter Ehe mit Elle Nolan verheiratet, die ebenfalls Anwältin ist, inzwischen jedoch Drehbücher schreibt. Nachdem sie sich von ihm getrennt hat, geraten die Eheleute bei einem Wiedersehen in eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf David seine Frau tötet. Er spricht darauf seine Aussage auf ein Diktiergerät und fährt zu Reginald, einem Kronanwalt und engstem Freund seines Vaters. Ihm beichtet er, dass Elle vor zwei Monaten die Trennung wollte, er bei seinem Besuch die Selbstbeherrschung verlor und sie mit seinen Händen erwürgt hat. Doch dem Rat von Reginald will David nicht folgen und er irrt deshalb so lange umher, bis er sich entschließt, zur Wohnung von Elle zurückzukehren. 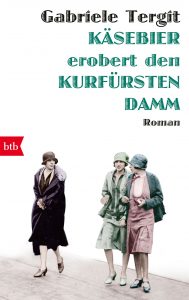 Die Neuauflage aus dem Jahre 2017 des bereits 1931 erschienenen Debütromans „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“ von Gabriele Tergit ist mit gutem Grund in der alten Rechtschreibung gehalten, wie Nicole Henneberg in einigen Hintergrundinformationen und biografischen Angaben zur Autorin am Schluss erklärt. Der Plot ist im Jahr 1929 angesiedelt, sechs Jahre nach der Währungsreform im November 1923. Wohnraum wurde immer knapper, durch Rationalisierungen stiegen die Arbeitslosenzahlen und mit ihnen begann der Aufstieg der Nationalsozialisten. Davon schreibt Gabriele Tergit, die selbst Redakteurin war, und beginnt ihren Roman mit einer Unterhaltung in den Räumen der Berliner Rundschau.
Die Neuauflage aus dem Jahre 2017 des bereits 1931 erschienenen Debütromans „Käsebier erobert den Kurfürstendamm“ von Gabriele Tergit ist mit gutem Grund in der alten Rechtschreibung gehalten, wie Nicole Henneberg in einigen Hintergrundinformationen und biografischen Angaben zur Autorin am Schluss erklärt. Der Plot ist im Jahr 1929 angesiedelt, sechs Jahre nach der Währungsreform im November 1923. Wohnraum wurde immer knapper, durch Rationalisierungen stiegen die Arbeitslosenzahlen und mit ihnen begann der Aufstieg der Nationalsozialisten. Davon schreibt Gabriele Tergit, die selbst Redakteurin war, und beginnt ihren Roman mit einer Unterhaltung in den Räumen der Berliner Rundschau.