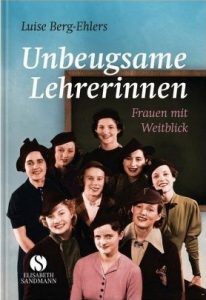 Allein der Titel “Unbeugsame Lehrerinnen” macht schon deutlich, dass es sich in dem Buch von Luise Berg-Ehlers um Frauen handelt, die den Kampf für eine ihnen wichtige Sache aufgenommen haben: Die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Bis in unsere Tage ist die soziale und politische Gleichstellung der Frau nur zum Teil verwirklicht worden, denn sonst hätte es kaum eine gesetzlich geforderte Frauenquote geben müssen, wie sie der Bundestag erst im März dieses Jahres beschlossen hat.
Allein der Titel “Unbeugsame Lehrerinnen” macht schon deutlich, dass es sich in dem Buch von Luise Berg-Ehlers um Frauen handelt, die den Kampf für eine ihnen wichtige Sache aufgenommen haben: Die Gleichberechtigung von Mann und Frau. Bis in unsere Tage ist die soziale und politische Gleichstellung der Frau nur zum Teil verwirklicht worden, denn sonst hätte es kaum eine gesetzlich geforderte Frauenquote geben müssen, wie sie der Bundestag erst im März dieses Jahres beschlossen hat.
Die Autorin macht zunächst deutlich, dass Frauen, die bis ins 20. Jahrhundert hinein den Lehrerberuf anstrebten, die Emanzipationsbewegung entscheidend beeinflusst haben und stellt in diesem Zusammenhang das Leben der drei Brontë-Schwestern vor. Um die gesellschaftliche Stellung einer Gouvernante zu beleuchten sowie die Anforderungen, die an sie gestellt wurden, führt sie Louise Lehzen, die für die spätere Königin Victoria zuständig war und Marion Crawford, Gouvernante für Elizabeth, von den Engländern nur Queen Mum genannt, an.

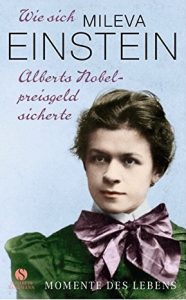 Albert Einstein dürfte jeder kennen, doch wer hat schon von seiner ersten Ehefrau Mileva Einstein gehört? Anne-Kathrin Kilg-Meyer hat in ihrem Buch ein Porträt dieser außergewöhnlichen Frau gezeichnet, die 1875 im heutigen Serbien zur Welt kommt. Nach einer unbeschwerten Kindheit geht die erst Neunzehnjährige alleine in die Schweiz, die ihr ein Studium in den Fächern Medizin, Mathematik und Physik ermöglicht. Dort trifft sie auf ihren späteren Ehemann Albert, und in der Folgezeit tauschen sie in Briefen sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse, als auch Liebesschwüre aus. Die beiden heiraten und trotz dreimaliger Mutterschaft unterstützt Mileva ihren Mann bei seinen Studien- und Forschungsarbeiten in Bern, da er sie als ebenbürtige Partnerin anerkennt. Doch mit achtunddreißig Jahren muss Mileva erkennen, dass ihr Mann sie mit seiner Cousine Elsa betrügt. Fast zeitgleich mit Beginn des Ersten Weltkrieges kommt es zur Trennung, und um ihren Kindern weiterhin eine beste Ausbildung zukommen zu lassen, muss Mileva Hunger leiden.
Albert Einstein dürfte jeder kennen, doch wer hat schon von seiner ersten Ehefrau Mileva Einstein gehört? Anne-Kathrin Kilg-Meyer hat in ihrem Buch ein Porträt dieser außergewöhnlichen Frau gezeichnet, die 1875 im heutigen Serbien zur Welt kommt. Nach einer unbeschwerten Kindheit geht die erst Neunzehnjährige alleine in die Schweiz, die ihr ein Studium in den Fächern Medizin, Mathematik und Physik ermöglicht. Dort trifft sie auf ihren späteren Ehemann Albert, und in der Folgezeit tauschen sie in Briefen sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse, als auch Liebesschwüre aus. Die beiden heiraten und trotz dreimaliger Mutterschaft unterstützt Mileva ihren Mann bei seinen Studien- und Forschungsarbeiten in Bern, da er sie als ebenbürtige Partnerin anerkennt. Doch mit achtunddreißig Jahren muss Mileva erkennen, dass ihr Mann sie mit seiner Cousine Elsa betrügt. Fast zeitgleich mit Beginn des Ersten Weltkrieges kommt es zur Trennung, und um ihren Kindern weiterhin eine beste Ausbildung zukommen zu lassen, muss Mileva Hunger leiden. 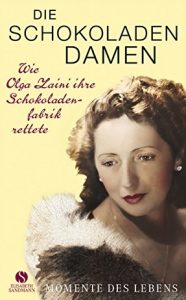 In dem Ferienhaus ihrer Eltern in Cunardo, nahe des Lago Maggiore gelegen, lernt die 1899 geborene Olga den Begründer und Inhaber der Mailänder Schokoladenfabrik, Luigi Zaini, kennen. Als seine Frau Luisa 1923 stirbt und dem Fünfundvierzigjährigen zwei kleine Kinder hinterlässt, heiratet er im Jahr darauf Olga, die ein Diplom als Buchhalterin hat, was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich war. Um die mit in die Ehe gebrachten Kinder Piero und Rosetta, wie auch für die gemeinsamen Kinder Luisa und Vittorio, kümmert sich ein Dienstmädchen. Der Familie geht es finanziell gut, sie beschäftigen weitere Bedienstete und verbringen die Sommer in einem Haus am Comer See. Doch im Jahr 1938 wird bei Luigi ein Hirntumor entdeckt. Das Unternehmen beschäftigt zu der Zeit einhundert Mitarbeiter, und Luigi äußert den Wunsch, dass Olga die Unternehmensführung übernimmt, bis die Söhne dazu in der Lage sind.
In dem Ferienhaus ihrer Eltern in Cunardo, nahe des Lago Maggiore gelegen, lernt die 1899 geborene Olga den Begründer und Inhaber der Mailänder Schokoladenfabrik, Luigi Zaini, kennen. Als seine Frau Luisa 1923 stirbt und dem Fünfundvierzigjährigen zwei kleine Kinder hinterlässt, heiratet er im Jahr darauf Olga, die ein Diplom als Buchhalterin hat, was für die damalige Zeit sehr ungewöhnlich war. Um die mit in die Ehe gebrachten Kinder Piero und Rosetta, wie auch für die gemeinsamen Kinder Luisa und Vittorio, kümmert sich ein Dienstmädchen. Der Familie geht es finanziell gut, sie beschäftigen weitere Bedienstete und verbringen die Sommer in einem Haus am Comer See. Doch im Jahr 1938 wird bei Luigi ein Hirntumor entdeckt. Das Unternehmen beschäftigt zu der Zeit einhundert Mitarbeiter, und Luigi äußert den Wunsch, dass Olga die Unternehmensführung übernimmt, bis die Söhne dazu in der Lage sind.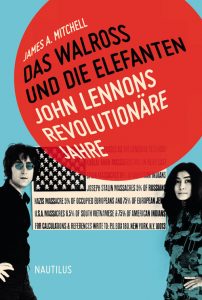 James A. Mitchell hat sich mit seinem Buch “Das Walross und die Elefanten” an die schwierige Aufgabe gewagt, ein Porträt von John Lennon während der Jahre nach der Trennung von den Beatles und seinem Umzug von London nach New York zu zeichnen. Dieser zur Legende gewordene Musiker hat innerhalb weniger Stunden die Freilassung des Bürgerrechtlers John Sinclair bewirken können. Politiker wollten seinen Einfluss für die Präsidentschaftswahlen nutzen, um Nixon zu stürzen. Doch nach seiner Wiederwahl reagierte man prompt und verweigerte Lennon die Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung. Wie den Ausführungen von James A. Mitchell weiter zu entnehmen ist, drohte man dem verheirateten Lennon sogar mit der Ausweisung, die eine Trennung von seiner Frau Yoko Ono bedeutet hätte, die auf der Suche nach ihrer Tochter in Amerika bleiben wollte. Es war dem Musiker nicht einmal möglich, das Land zu verlassen, weil ihm dann unter Umständen die Wiedereinreise versagt worden wäre, wie es Jahrzehnte zuvor Charly Chaplin passierte.
James A. Mitchell hat sich mit seinem Buch “Das Walross und die Elefanten” an die schwierige Aufgabe gewagt, ein Porträt von John Lennon während der Jahre nach der Trennung von den Beatles und seinem Umzug von London nach New York zu zeichnen. Dieser zur Legende gewordene Musiker hat innerhalb weniger Stunden die Freilassung des Bürgerrechtlers John Sinclair bewirken können. Politiker wollten seinen Einfluss für die Präsidentschaftswahlen nutzen, um Nixon zu stürzen. Doch nach seiner Wiederwahl reagierte man prompt und verweigerte Lennon die Verlängerung seiner Aufenthaltsgenehmigung. Wie den Ausführungen von James A. Mitchell weiter zu entnehmen ist, drohte man dem verheirateten Lennon sogar mit der Ausweisung, die eine Trennung von seiner Frau Yoko Ono bedeutet hätte, die auf der Suche nach ihrer Tochter in Amerika bleiben wollte. Es war dem Musiker nicht einmal möglich, das Land zu verlassen, weil ihm dann unter Umständen die Wiedereinreise versagt worden wäre, wie es Jahrzehnte zuvor Charly Chaplin passierte.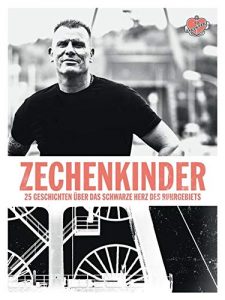 David Schraven gibt in seinem Buch “Zechenkinder” Geschichten von Bergleuten wieder, die alle eine Verbundenheit zum Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop haben. Sie schildern ihre Erinnerungen an eine Großdemo für einen sozialverträglichen Ausstieg, den Papstbesuch, das nächtliche Abfackeln der Kokereien, an verheerende Grubenbrände und eine Menschenkette, die sich quer durchs Ruhrgebiet zog und somit zum Band der Solidarität wurde. Sie berichten von Unfällen und der viel gepriesenen Kameradschaft unter den Kumpeln, wobei einer diese nie erlebt hat und ein anderer nur Konkurrenzkampf kennt. Es geht um erlebte Enttäuschungen und das Gefühl, verarscht worden zu sein. Der eine hat sein Glück beim Tunnelbau in der Schweiz gesucht und ein anderer hat von der Maloche unter Tage zum Psychologiestudium gewechselt, während ein Koreaner wegen des Bergbaus ins Ruhrgebiet kam und blieb.
David Schraven gibt in seinem Buch “Zechenkinder” Geschichten von Bergleuten wieder, die alle eine Verbundenheit zum Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop haben. Sie schildern ihre Erinnerungen an eine Großdemo für einen sozialverträglichen Ausstieg, den Papstbesuch, das nächtliche Abfackeln der Kokereien, an verheerende Grubenbrände und eine Menschenkette, die sich quer durchs Ruhrgebiet zog und somit zum Band der Solidarität wurde. Sie berichten von Unfällen und der viel gepriesenen Kameradschaft unter den Kumpeln, wobei einer diese nie erlebt hat und ein anderer nur Konkurrenzkampf kennt. Es geht um erlebte Enttäuschungen und das Gefühl, verarscht worden zu sein. Der eine hat sein Glück beim Tunnelbau in der Schweiz gesucht und ein anderer hat von der Maloche unter Tage zum Psychologiestudium gewechselt, während ein Koreaner wegen des Bergbaus ins Ruhrgebiet kam und blieb.
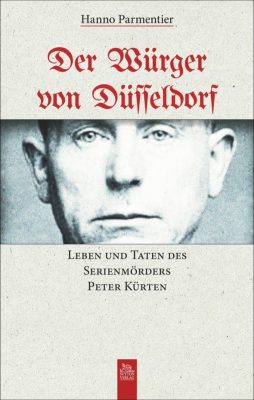
 Nicht allen vorgestellten Frauen in dem Buch “Heldinnen – 45 Vorbilder fürs Leben” vom Elisabeth Sandmann Verlag ist ihr Lebensweg an der Wiege gesungen worden. Einige von ihnen stammten beziehungsweise stammen aus ärmlichen Verhältnissen und konnten sich durch heldenhaften Mut und Tapferkeit auszeichnen. In Bild und Text werden beispielhafte Karrieren, aber auch traurige Schicksale vorgestellt. Ein Teil der Frauen hat durch Gesang, Tanz oder als Schauspielerin Berühmtheit erlangt und wegen ihrer Schönheit sind viele von ihnen auch beneidet worden. Ein anderer Teil hat sich für Hilfsprojekte engagiert oder für bedrohte Tierarten und Menschen in Not stark gemacht. Von den fünfundvierzig ausgewählten Frauen leben noch dreiundzwanzig, andere sind schon vor Jahrzehnten gestorben und manch eine in viel zu jungen Jahren.
Nicht allen vorgestellten Frauen in dem Buch “Heldinnen – 45 Vorbilder fürs Leben” vom Elisabeth Sandmann Verlag ist ihr Lebensweg an der Wiege gesungen worden. Einige von ihnen stammten beziehungsweise stammen aus ärmlichen Verhältnissen und konnten sich durch heldenhaften Mut und Tapferkeit auszeichnen. In Bild und Text werden beispielhafte Karrieren, aber auch traurige Schicksale vorgestellt. Ein Teil der Frauen hat durch Gesang, Tanz oder als Schauspielerin Berühmtheit erlangt und wegen ihrer Schönheit sind viele von ihnen auch beneidet worden. Ein anderer Teil hat sich für Hilfsprojekte engagiert oder für bedrohte Tierarten und Menschen in Not stark gemacht. Von den fünfundvierzig ausgewählten Frauen leben noch dreiundzwanzig, andere sind schon vor Jahrzehnten gestorben und manch eine in viel zu jungen Jahren.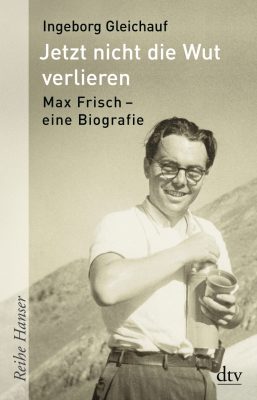
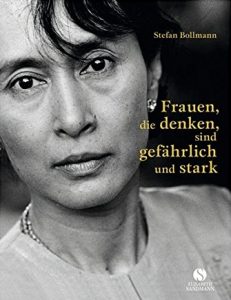 Frauen müssen auch heute noch einen Spagat machen, wenn sie ihr Familienleben mit einer Berufstätigkeit vereinbaren wollen und darüber hinaus werden sie oftmals noch geringer bezahlt wie ihre männlichen Kollegen. In Deutschland wurden sie erst ab 1908 zum Studium zugelassen und die Frage, was angeboren oder anerzogen ist, sorgt immer noch für Diskussionsstoff. Das Buch “Frauen, die denken, sind gefährlich und stark” ist eine Geschichte der Emanzipation, denn durch den kriegsbedingten Frauenüberschuss nach dem 1. Weltkrieg mussten die Frauen „ihren Mann stehen“, woraus ein gestärktes Selbstbewusstsein resultierte. Die Emanzipation hat erst durch diesen Krieg einen ungeahnten Vorschub erfahren, wie Stefan Bollmann schreibt.
Frauen müssen auch heute noch einen Spagat machen, wenn sie ihr Familienleben mit einer Berufstätigkeit vereinbaren wollen und darüber hinaus werden sie oftmals noch geringer bezahlt wie ihre männlichen Kollegen. In Deutschland wurden sie erst ab 1908 zum Studium zugelassen und die Frage, was angeboren oder anerzogen ist, sorgt immer noch für Diskussionsstoff. Das Buch “Frauen, die denken, sind gefährlich und stark” ist eine Geschichte der Emanzipation, denn durch den kriegsbedingten Frauenüberschuss nach dem 1. Weltkrieg mussten die Frauen „ihren Mann stehen“, woraus ein gestärktes Selbstbewusstsein resultierte. Die Emanzipation hat erst durch diesen Krieg einen ungeahnten Vorschub erfahren, wie Stefan Bollmann schreibt.