 In ihrem Ratgeber Bewusst verändern* verdeutlicht Heike Bettendorf die unterschiedlichen Einflüsse, die auf uns einwirken können. Diese Energien können bewusst wahrgenommen werden oder uns auch unbewusst beeinflussen. Daher ist es wichtig, die verschiedenen Formen von Energie zu verstehen, um diese Einflüsse für uns gezielt zu nutzen und mehr Wohlbefinden zu erlangen. Zeitweise schaden wir uns mit manchen Energien selbst und suchen den Schuldigen für unsere Probleme in unserem Umfeld. Doch sollten wir eigentlich wissen, dass der Schlüssel für eine Lösung in uns selbst liegt und mit Selbstverantwortung eine andere Entwicklung möglich ist. „Bewusstsein ist der Beginn der Transformation“ schreibt die Autorin, denn manchen Menschen ist gar nicht bewusst, wie sie Veränderungen angehen könnten, um das eigene Wohlbefinden zu verbessern. Deshalb braucht es Klarheit darüber, welches Resultat erreicht werden soll.
In ihrem Ratgeber Bewusst verändern* verdeutlicht Heike Bettendorf die unterschiedlichen Einflüsse, die auf uns einwirken können. Diese Energien können bewusst wahrgenommen werden oder uns auch unbewusst beeinflussen. Daher ist es wichtig, die verschiedenen Formen von Energie zu verstehen, um diese Einflüsse für uns gezielt zu nutzen und mehr Wohlbefinden zu erlangen. Zeitweise schaden wir uns mit manchen Energien selbst und suchen den Schuldigen für unsere Probleme in unserem Umfeld. Doch sollten wir eigentlich wissen, dass der Schlüssel für eine Lösung in uns selbst liegt und mit Selbstverantwortung eine andere Entwicklung möglich ist. „Bewusstsein ist der Beginn der Transformation“ schreibt die Autorin, denn manchen Menschen ist gar nicht bewusst, wie sie Veränderungen angehen könnten, um das eigene Wohlbefinden zu verbessern. Deshalb braucht es Klarheit darüber, welches Resultat erreicht werden soll.
Michael Petrikowski
Der Riss in der Wand von Ina Maschner
 Mit sechsundzwanzig Jahren lebt Hedwig noch immer bei ihren Eltern in einem Reihenhaus aus den 1960er Jahren am Rande von Innsbruck. Nachdem sie mit achtzehn Jahren die Matura erhalten hat, machte sie mehrere Praktika und hat kleine Jobs ausprobiert. Ihre letzte Anstellung in einer Kunstgalerie musste sie schweren Herzens kündigen, weil ihre Eltern von ihr mehr Unterstützung im Haushalt erwarteten. Seit Jahren ist es ihr größter Wunsch Künstlerin zu werden und ein Kunststudium in Wien zu absolvieren, denn Zeichnen ist ihre Leidenschaft. Doch hat sie sich bisher nicht getraut, ihren Traum zu verwirklichen, denn dafür müsste sie, wie ihr älterer Bruder Franz, das Elternhaus verlassen und nach Wien ziehen. Sie vermisst ihren Bruder, der sich nach seinem Auszug vor einigen Jahren nicht mehr gemeldet hat, und hofft, dass er eines Tages zurückkehren wird.
Mit sechsundzwanzig Jahren lebt Hedwig noch immer bei ihren Eltern in einem Reihenhaus aus den 1960er Jahren am Rande von Innsbruck. Nachdem sie mit achtzehn Jahren die Matura erhalten hat, machte sie mehrere Praktika und hat kleine Jobs ausprobiert. Ihre letzte Anstellung in einer Kunstgalerie musste sie schweren Herzens kündigen, weil ihre Eltern von ihr mehr Unterstützung im Haushalt erwarteten. Seit Jahren ist es ihr größter Wunsch Künstlerin zu werden und ein Kunststudium in Wien zu absolvieren, denn Zeichnen ist ihre Leidenschaft. Doch hat sie sich bisher nicht getraut, ihren Traum zu verwirklichen, denn dafür müsste sie, wie ihr älterer Bruder Franz, das Elternhaus verlassen und nach Wien ziehen. Sie vermisst ihren Bruder, der sich nach seinem Auszug vor einigen Jahren nicht mehr gemeldet hat, und hofft, dass er eines Tages zurückkehren wird.
Nachdem Hedwig allen Mut zusammen genommen und sich für ein Studium an der Kunsthochschule in Wien beworben hat, erhält sie eine Zusage für das Studium. In ihrer ersten Begeisterung möchte sie den Eltern von ihrer erfolgreichen Bewerbung erzählen.
Der Pakt der Frauen von Julia Kröhn
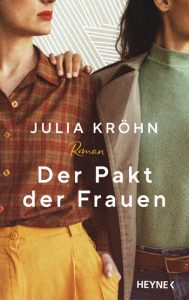 Die Historikerin Dr. Katharina Adler ist Dozentin am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien. Sie ist Expertin für Sozial-, Alltags- und Frauengeschichte und hat ein mehrmonatiges Stipendium in den USA erhalten, um neue wissenschaftliche Impulse nach Österreich zu bringen. Doch um die neu geschaffene Stelle einer Assistenzprofessur, die eigentlich an sie gehen sollte, zu bekommen, muss sie im nächsten Semester eine Übung abhalten. Aus dem Institut für Osteuropäische Geschichte wurde beim Bildungsministerium Einspruch gegen die Vergabe erhoben, denn Dr. Florian Bruckmann, der ebenfalls an der Assistenzprofessur interessiert ist, will mit einer eigenen Lehrveranstaltung die Professoren von seiner Kompetenz überzeugen.
Die Historikerin Dr. Katharina Adler ist Dozentin am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien. Sie ist Expertin für Sozial-, Alltags- und Frauengeschichte und hat ein mehrmonatiges Stipendium in den USA erhalten, um neue wissenschaftliche Impulse nach Österreich zu bringen. Doch um die neu geschaffene Stelle einer Assistenzprofessur, die eigentlich an sie gehen sollte, zu bekommen, muss sie im nächsten Semester eine Übung abhalten. Aus dem Institut für Osteuropäische Geschichte wurde beim Bildungsministerium Einspruch gegen die Vergabe erhoben, denn Dr. Florian Bruckmann, der ebenfalls an der Assistenzprofessur interessiert ist, will mit einer eigenen Lehrveranstaltung die Professoren von seiner Kompetenz überzeugen.
Im Gegensatz zu Florian Bruckmann, der sich bestens auf seine Aufgabe vorbereitet hat, trifft Katharina die Entscheidung des Professorenkollegiums völlig überraschend. Als Bruckmann ihr kurz darauf im Gang des Instituts begegnet, schenkt er ihr eine Blattsammlung, ein Kochbuch aus dem 19. Jahrhundert, und möchte von ihr wissen, welches Thema sie für ihre Lehrveranstaltung ausgewählt hat.
Wolfszone von Christian Endres
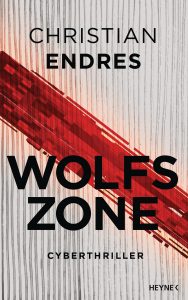 Der Cyberthriller Wolfszone* von Christian Endres ist in einer nahen Zukunft in Deutschland angesiedelt. Weltweit hat die Bevölkerung mit Pandemien und Extremwetter zu kämpfen. In einem Waldgebiet nahe der polnischen Grenze hat eine Forschungseinrichtung illegal Hightechmüll entsorgt, wodurch experimentelle Nanobots mit den Überwachungsimplantaten der heimischen Wölfe interagieren konnten und diese in riesige Cyborgs verwandelt haben. Direkt hinter dem Dorf Dölmow hat die Bundeswehr eine Sperrzone eingerichtet, die von Soldaten und Drohnen überwacht wird. Im Ort selbst tummeln sich Journalisten, Wissenschaftler und Umweltaktivisten der Bewegung ProW@lf. Während in Berlin die Auseinandersetzungen zwischen Wolfsgegnern und Aktivisten außer Kontrolle geraten sind, soll in einigen Tagen im Parlament über das weitere Vorgehen des Militärs entschieden werden.
Der Cyberthriller Wolfszone* von Christian Endres ist in einer nahen Zukunft in Deutschland angesiedelt. Weltweit hat die Bevölkerung mit Pandemien und Extremwetter zu kämpfen. In einem Waldgebiet nahe der polnischen Grenze hat eine Forschungseinrichtung illegal Hightechmüll entsorgt, wodurch experimentelle Nanobots mit den Überwachungsimplantaten der heimischen Wölfe interagieren konnten und diese in riesige Cyborgs verwandelt haben. Direkt hinter dem Dorf Dölmow hat die Bundeswehr eine Sperrzone eingerichtet, die von Soldaten und Drohnen überwacht wird. Im Ort selbst tummeln sich Journalisten, Wissenschaftler und Umweltaktivisten der Bewegung ProW@lf. Während in Berlin die Auseinandersetzungen zwischen Wolfsgegnern und Aktivisten außer Kontrolle geraten sind, soll in einigen Tagen im Parlament über das weitere Vorgehen des Militärs entschieden werden.
Lisa Kraupen, die Tochter der Chefin des mächtigsten Rüstungskonzerns in Europa, der Milliardärin Sylvia Kraupen, hat sich unter falschem Namen den Umweltaktivisten von ProW@lf in Dölmow angeschlossen, doch seit einigen Tagen hat sie sich nicht mehr bei ihrer Mutter gemeldet.
Kafkas Puppe von Gerd Schneider
 An einem sonnigen Tag im Oktober 1923 geht Franz Kafka im Park am Steglitzer Wasserturm in Berlin spazieren. Auf einer Bank hockt ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen, das weint, weil ihre Puppe verschwunden ist, die sie während des Spielens auf eine Bank gesetzt hatte. Sie glaubt, dass ihre Puppe von jemandem gestohlen wurde. Kafka erkundigt sich, wie die Puppe denn ausgesehen habe, und das Mädchen Lena beschreibt ihm ganz genau, wie die Stoffpuppe aussieht. Um sie zu trösten, behauptet Kafka, dass die Puppe nicht gestohlen wurde, denn er habe sie gesehen, wie sie ihm am Eingang des Parks entgegen kam und zu ihm gesagt hätte, sie wolle ihr schreiben.
An einem sonnigen Tag im Oktober 1923 geht Franz Kafka im Park am Steglitzer Wasserturm in Berlin spazieren. Auf einer Bank hockt ein kleines Mädchen mit blonden Zöpfen, das weint, weil ihre Puppe verschwunden ist, die sie während des Spielens auf eine Bank gesetzt hatte. Sie glaubt, dass ihre Puppe von jemandem gestohlen wurde. Kafka erkundigt sich, wie die Puppe denn ausgesehen habe, und das Mädchen Lena beschreibt ihm ganz genau, wie die Stoffpuppe aussieht. Um sie zu trösten, behauptet Kafka, dass die Puppe nicht gestohlen wurde, denn er habe sie gesehen, wie sie ihm am Eingang des Parks entgegen kam und zu ihm gesagt hätte, sie wolle ihr schreiben.
Am nächsten Tag geht Kafka zur selben Uhrzeit in den Park in der Hoffnung, die kleine Lena dort zu treffen. Als sie endlich auftaucht, überreicht er ihr einen Brief, den angeblich ihre Puppe geschrieben hat.
Hummer to go von Rüdiger Bertram
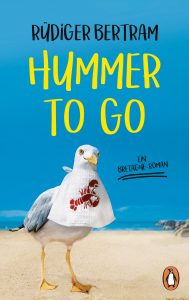 Frank Berger hat gerade seinen Job verloren und viel Zeit, denn er hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Da sich niemand für seine Fotos von einem Urlaub in Venedig interessiert, kommt ihm die Idee, dass jeder Fotos besitzt, die keiner sehen will. So gibt er eine Anzeige auf: “Sehe mir gegen Honorar mit regem Interesse Ihre Urlaubsfotos an.” Keine halbe Stunde, nachdem die Anzeige online ist, bekommt er bereits den ersten Auftrag, bei dem er das Leben seines Kunden in fünftausend Fotos betrachten darf. Während dieser Zeit sind zwanzig neue Aufträge auf seinem Handy eingegangen. Er hätte niemals gedacht, dass sich durch Nichtstun so viel Geld verdienen lässt.
Frank Berger hat gerade seinen Job verloren und viel Zeit, denn er hat keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Da sich niemand für seine Fotos von einem Urlaub in Venedig interessiert, kommt ihm die Idee, dass jeder Fotos besitzt, die keiner sehen will. So gibt er eine Anzeige auf: “Sehe mir gegen Honorar mit regem Interesse Ihre Urlaubsfotos an.” Keine halbe Stunde, nachdem die Anzeige online ist, bekommt er bereits den ersten Auftrag, bei dem er das Leben seines Kunden in fünftausend Fotos betrachten darf. Während dieser Zeit sind zwanzig neue Aufträge auf seinem Handy eingegangen. Er hätte niemals gedacht, dass sich durch Nichtstun so viel Geld verdienen lässt.
Nach nicht einmal einem Jahr hat sein Unternehmen fünfhundertzwanzig Mitarbeiter und Filialen in allen großen deutschen Städten. Doch Frank geht weiterhin lieber Fotos bei den Kunden anschauen als Bilanzen zu prüfen, denn dafür hat er Leute eingestellt, die sich um das Geschäftliche kümmern.
Der perfekte Mann von Ernest van der Kwast
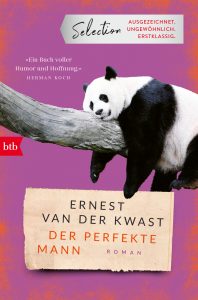 Der Kunsthistoriker Peter Lindke bewohnt seit kurzem mit seiner Frau Kee und den beiden Söhnen Tristen und Ewan ein Reihenhaus in einem sozial gemischten Quartier inmitten von Sozialwohnungen aus den achtziger Jahren. Die Stadt hatte einen Teil der alten Mietshäuser abgerissen und an deren Stelle einige schicke Reihenhäuser gebaut, um Wohnraum für Besserverdienende zu schaffen. Das Neubauprojekt soll das Viertel verbessern und dafür sorgen, dass gut ausgebildete Familien in Rotterdam bleiben. Peter arbeitet als Kurator der Abteilung für niederländische Barockmalerei am örtlichen Museum, seine Frau Kee ist eine erfolgreiche Illustratorin. Doch in ihrer Ehe kriselt es, denn während Kee sich auch noch um den Haushalt und die Kinder kümmern muss, vergräbt sich Peter in seiner Arbeit.
Der Kunsthistoriker Peter Lindke bewohnt seit kurzem mit seiner Frau Kee und den beiden Söhnen Tristen und Ewan ein Reihenhaus in einem sozial gemischten Quartier inmitten von Sozialwohnungen aus den achtziger Jahren. Die Stadt hatte einen Teil der alten Mietshäuser abgerissen und an deren Stelle einige schicke Reihenhäuser gebaut, um Wohnraum für Besserverdienende zu schaffen. Das Neubauprojekt soll das Viertel verbessern und dafür sorgen, dass gut ausgebildete Familien in Rotterdam bleiben. Peter arbeitet als Kurator der Abteilung für niederländische Barockmalerei am örtlichen Museum, seine Frau Kee ist eine erfolgreiche Illustratorin. Doch in ihrer Ehe kriselt es, denn während Kee sich auch noch um den Haushalt und die Kinder kümmern muss, vergräbt sich Peter in seiner Arbeit.
Als ein angeblich neuer Rembrandt entdeckt wird, das Porträt eines unbekannten jungen Mannes, widerspricht Peter dieser Zuschreibung, obwohl mehrere Experten die Echtheit des Gemäldes bestätigt haben.
Knochensuppe – Die Nacht, in der zwölf Menschen verschwanden von Youngtak Kim
 Nachdem Lee Uhwan gelernt hat, wie die Knochensuppe zubereitet wird und er die erforderlichen Zutaten besorgt hat, ist sein Auftrag erfüllt und er kann mit dem Boot zurück in die Zukunft reisen. Doch in letzter Sekunde entschließt er sich, hier in dieser Zeit, an diesem Ort zu leben. Dabei hat er nicht bedacht, dass seine zwölf Mitreisenden zu Tode kommen, wenn er die Luke des Bootes plötzlich öffnet. Als Uhwan in das Lokal „Busaner Knochensuppe“ zurückkehrt, sind im Fernsehen zahlreiche Tote zu sehen, die von den Wellen an den Strand gespült wurden. Erst jetzt wird ihm bewusst, was er getan hat. Um weiterhin in Busan leben zu können, braucht Uhwan eine Idendität und deshalb wendet er sich an den Immobilienmakler Park Jongdae, der die Probleme der aus der Zukunft kommenden Zuwanderer aus eigener Erfahrung kennt und ihnen dabei hilft, ein neues Leben führen zu können.
Nachdem Lee Uhwan gelernt hat, wie die Knochensuppe zubereitet wird und er die erforderlichen Zutaten besorgt hat, ist sein Auftrag erfüllt und er kann mit dem Boot zurück in die Zukunft reisen. Doch in letzter Sekunde entschließt er sich, hier in dieser Zeit, an diesem Ort zu leben. Dabei hat er nicht bedacht, dass seine zwölf Mitreisenden zu Tode kommen, wenn er die Luke des Bootes plötzlich öffnet. Als Uhwan in das Lokal „Busaner Knochensuppe“ zurückkehrt, sind im Fernsehen zahlreiche Tote zu sehen, die von den Wellen an den Strand gespült wurden. Erst jetzt wird ihm bewusst, was er getan hat. Um weiterhin in Busan leben zu können, braucht Uhwan eine Idendität und deshalb wendet er sich an den Immobilienmakler Park Jongdae, der die Probleme der aus der Zukunft kommenden Zuwanderer aus eigener Erfahrung kennt und ihnen dabei hilft, ein neues Leben führen zu können.
Der junge Hwayeong wurde aus der Zukunft nach Busan geschickt, um Lee Uhwan zu töten. Nachdem er sich davon überzeugen konnte, dass sich dieser nicht unter den zwölf Toten vom Strand befindet, beschließt er, die über einhundert Lokale aufzusuchen, in denen Knochensuppe angeboten wird, um Uhwan zu finden und ihn zu töten.
weiterlesenKnochensuppe – Die Nacht, in der zwölf Menschen verschwanden von Youngtak Kim
Keine Reue von Ellen Sandberg
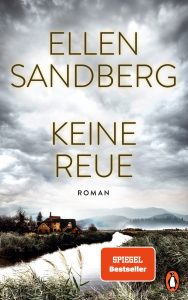 Die Anwältin Barbara und ihr Ehemann, der Publizist Gernot Maienfeld, leben in einer großzügigen Eigentumswohnung in Stuttgart, die sie Ende der 1980er Jahre gekauft haben. Als Barbaras Eltern kurz nacheinander verstorben sind, hat sie völlig unerwartet einen Teil des Millionenvermögens aus deren Textilfabrik geerbt. Obwohl sie die Erbschaft zunächst ausschlagen wollte, hat Gernot sie überredet, mit einem Teil des Geldes einige Organisationen zu unterstützen. Doch das ausschlaggebende Argument für sie war, dass sie sich mit dem Geld eine kleine Wohnung in Stuttgart, Frankfurt oder München leisten könnten. Die Aussicht, aus dem alten Haus in Buchsweiler auszuziehen und wieder in einer Stadt zu leben, war zu verlockend.
Die Anwältin Barbara und ihr Ehemann, der Publizist Gernot Maienfeld, leben in einer großzügigen Eigentumswohnung in Stuttgart, die sie Ende der 1980er Jahre gekauft haben. Als Barbaras Eltern kurz nacheinander verstorben sind, hat sie völlig unerwartet einen Teil des Millionenvermögens aus deren Textilfabrik geerbt. Obwohl sie die Erbschaft zunächst ausschlagen wollte, hat Gernot sie überredet, mit einem Teil des Geldes einige Organisationen zu unterstützen. Doch das ausschlaggebende Argument für sie war, dass sie sich mit dem Geld eine kleine Wohnung in Stuttgart, Frankfurt oder München leisten könnten. Die Aussicht, aus dem alten Haus in Buchsweiler auszuziehen und wieder in einer Stadt zu leben, war zu verlockend.
Doch statt einer kleinen Wohnung haben sie eine großzügige Wohnung mit Dachterrasse, Designermöbeln und einen Sportwagen für Gernot gekauft. Aus der einstigen Anwältin der RAF und dem linken Publizisten, der gegen das System und den Kapitalismus anschrieb, waren bourgeoise Salonlinke geworden.
Im nächsten Jahr zur selben Zeit von Jana Voosen
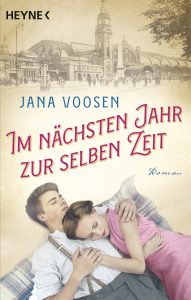 Anni, die Tochter des Hamburger Süßwarenfabrikanten Friedrich Brand, wünscht sich sehnlichst in den Familienbetrieb einzusteigen und würde gerne die Handelsschule besuchen. Doch ihr Vater ist der Meinung, dass Frauen sich mit den Aufgaben als Ehefrau und Mutter begnügen sollten und so schickt er sie für ein Jahr in die Haushaltsschule des Bundes Deutscher Mädels nach Köln. Als sie im Juni 1940 nach Hamburg zurückkehrt, trifft sie am Bahnhof ihre Eltern in Begleitung ihres älteren Bruders Hans, der inzwischen als Soldat eingezogen wurde und ausgerechnet zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr an die Front muss.
Anni, die Tochter des Hamburger Süßwarenfabrikanten Friedrich Brand, wünscht sich sehnlichst in den Familienbetrieb einzusteigen und würde gerne die Handelsschule besuchen. Doch ihr Vater ist der Meinung, dass Frauen sich mit den Aufgaben als Ehefrau und Mutter begnügen sollten und so schickt er sie für ein Jahr in die Haushaltsschule des Bundes Deutscher Mädels nach Köln. Als sie im Juni 1940 nach Hamburg zurückkehrt, trifft sie am Bahnhof ihre Eltern in Begleitung ihres älteren Bruders Hans, der inzwischen als Soldat eingezogen wurde und ausgerechnet zum Zeitpunkt ihrer Rückkehr an die Front muss.
Um Anni vor dem Pflichtjahr als Landarbeiterin zu bewahren, beschäftigt Friedrich sie als Hilfskraft in dem Büro seiner Sekretärin. Anni hofft, sich in der Firma hocharbeiten zu können und später einmal das leerstehende Büro neben dem ihres Vaters zu beziehen.
