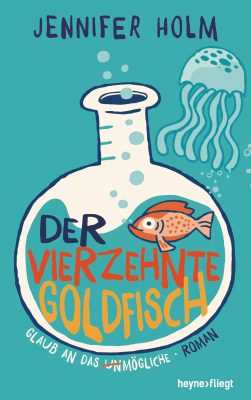
Ein ungewöhnlicher Großvater
Elli ist elf Jahre alt und lebt mit ihrer geschiedenen Mutter in der Nähe von San Francisco. Ihre frühere Babysitterin Nicole betreut sie, wenn ihre Mutter ihrer Arbeit als Schauspiellehrerin nachgeht. Eines Tages bringt Nicole einen dreizehnjährigen Jungen mit nach Hause, der von der Polizei aufgegriffen wurde, weil er sich unerlaubt Zugang zu einem Labor verschaffen wollte. Doch dieser Junge ist in Wahrheit Ellis 76-jähriger Großvater, der ein Mittel gegen das Altern entdeckt hat.
Die Geschichte von Melvin Herbert Sagarsky
Der Großvater, Melvin Herbert Sagarsky, berichtet seiner Enkelin, dass er seit vierzig Jahren Quallen erforscht, bereits zwei Doktortitel sowie einen Nobelpreis erhalten hat und seinen Jungbrunnen zunächst an Mäusen testete, bevor er das Mittel an sich selbst ausprobierte. Er wollte nicht länger schlechter sehen und hören oder ständig zur Toilette müssen. Nun muss er jedoch als Dreizehnjähriger wieder zur Schule gehen, leidet unter Akne und darf nicht mehr Auto fahren. Das wird zum Problem, denn er muss dringend in sein Labor, um Zugang zu einer besonderen Quallenart zu erhalten, die den Alterungsprozess umkehrt.
Die moralische Dimension des Jungbleibens
Im Verlauf der Handlung des Kinderbuchs Der vierzehnte Goldfisch* von Jennifer Holm erkennt Elli, dass das Leben nicht zwangsläufig besser wird, wenn man plötzlich wieder jünger ist. Wenn das eigene, erwachsen gewordene Kind dem Vater, der wieder zum Kind wurde, Vorschriften machen kann, stellt sich die Frage, wer eigentlich Verantwortung trägt. Die absurde Situation, dass Ellis Großvater als Dreizehnjähriger ihrer Mutter Anweisungen gibt, führt Elli zu einer Erkenntnis: Ihr Erzieher im Kindergarten hatte einen tieferen Gedanken, als er jedem Kind einen Goldfisch schenkte, der nicht lange leben würde. Erst sieben Jahre später gesteht ihre Mutter, die verstorbenen Fische durch neue ersetzt zu haben – ein Moment, der den eigentlichen Plot auslöst.
Wissenschaft als Chance und Risiko
Positiv hervorzuheben ist, dass das Buch betont, wie wichtig es ist, bei Kindern Interesse zu wecken – insbesondere für Wissenschaft. Es zeigt, dass Forscher sowohl zum Nutzen als auch zum Schaden der Menschheit beitragen können. Als Beispiele nennt die Autorin Jonas Salk, den Entwickler eines Impfstoffs gegen Polio, und Julius Robert Oppenheimer, den Vater der Atombombe. Auch Namen wie Marie Curie, Louis Pasteur oder Isaac Newton werden erwähnt. Doch stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, so viele historische Persönlichkeiten aufzuführen, wenn junge Leser keine Verbindung zu ihnen herstellen können.
Überfrachtung mit Nebensächlichkeiten
Jennifer Holm spricht in ihrem Buch zahlreiche, teils belanglose Themen an. Dass Babysitterin Nicole einen neuen Job bekommt oder Brianna, eine Freundin von Elli, ein intensives Volleyballtraining beginnt, sind Beispiele dafür. Auch wenn ein geschiedener Mann seiner Ex-Frau handwerklich hilft, bleibt fraglich, warum ausgerechnet chinesisches Essen mit dem umstrittenen Geschmacksverstärker Glutamat als Lieblingsspeise des Großvaters mehrfach erwähnt wird. Während sich Kinder unter einem Taco oder Burrito vielleicht etwas vorstellen können, bleiben Begriffe wie Quesadilla, Fajitas, Guacamole oder Corn-Dog-Tag oft unverständlich. Ebenso wenig wird erklärt, was ein binokulares Mikroskop ist. Und ob Kinder den Fachbegriff „Seneszenz“ für den Alterungsprozess kennen müssen, ist ebenfalls fraglich.
Fazit: Gute Ansätze, aber wenig altersgerechte Umsetzung
Wenn Wissen für eine bestimmte Altersgruppe transparent und verständlich vermittelt wird, ist das sehr zu begrüßen. Leider gelingt dies in Der vierzehnte Goldfisch* nur bedingt. Trotz interessanter Ansätze bleibt der Roman in vielen Punkten überladen und für die empfohlene Altersgruppe von elf Jahren nicht immer nachvollziehbar.
Der vierzehnte Goldfisch von Jennifer Holm
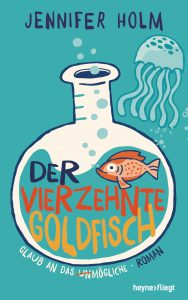
Übersetzung von Beate Brammertz
Heyne Verlag 2015
Hardcover
176 Seiten
ISBN 978-3-453-27022-0
