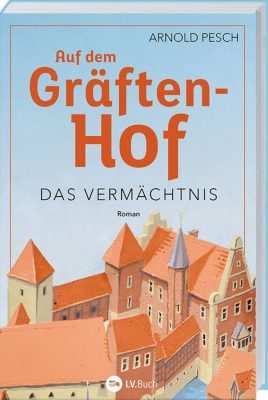
Die Höfe im Münsterland und ein besonderes Erbe
Franziska, die mit Johannes verheiratet ist und mit ihm die Kinder Ludger, Barbara und Alexa hat, erbt nach dem Tod ihres Vaters den Bawinkelschen Hof im Münsterland. Als ihre Nachbarn Maria und Wilhelm Schulze-Westhoff vom bedeutend größeren Gräftenhof nach zwei Fehlgeburten endlich einen Sohn bekommen, schwindet mit dem am Down-Syndrom leidenden Paul alle Hoffnung auf einen Hoferben. In kluger Voraussicht bitten sie Johannes, die Patenschaft für Paul zu übernehmen – für den Fall, dass ihnen etwas zustoßen sollte, würden sich ihre Nachbarn um den kranken Jungen kümmern.
Ein Angebot aus Verantwortung
Als Wilhelm zunehmend seine Kräfte schwinden sieht, beschließt er gemeinsam mit seiner Frau Maria, den Gräftenhof den Nachbarn zum Kauf anzubieten, um ihn in guten Händen zu wissen. Franziska und Johannes lehnen das großzügige Angebot zunächst ab, da mit Paul ein rechtmäßiger Erbe existiert. Um dem Jungen jedoch gerecht zu werden, der eine ausgeprägte Liebe zu Tieren entwickelt hat, unterbreiten sie ein Gegenangebot, das schließlich notariell beurkundet wird: Den Gräftenhof, der durch den Waldsee eine natürliche Grenze zum Bawinkelschen Hof bildet, wollen sie in Erbpacht übernehmen und ihren Nachbarn – insbesondere auch dem kranken Paul – nach dem Tod seiner Eltern ein lebenslanges Wohnrecht in einem noch umzubauenden Fachwerkspeicher einräumen.
Die nächste Generation und neue Ideen
Die Jahre vergehen. Ludger besucht die Landwirtschaftshochschule mit dem Ziel, Diplomagrarwirt zu werden. Aufgrund neuer Erfahrungen möchte er statt Viehhaltung in den Getreideanbau investieren und verliebt sich in Viktoria. Barbara entwickelt die Idee, den Gräftenhof in einen Reiterhof umzuwandeln. Sie lehnt den Heiratsantrag von Bernward, einem Sohn des Fürsten, ab und wird von ihrem Gewissen geplagt, als auch Conrad – ein lieber Freund aus Kindheitstagen – um ihre Hand anhält. Da er ihr Cousin ist, fürchtet sie, mit ihm womöglich kein gesundes Kind zeugen zu können.
Ein Protagonist mit bewegter Vergangenheit
Arnold Pesch, der seinen Roman Auf dem Gräftenhof vor dem russischen Überfall auf die Ukraine verfasste, hat mit Johannes einen Schwarzmeerdeutschen als Protagonisten geschaffen. Dieser wurde im Zweiten Weltkrieg zum Wehrdienst eingezogen und beim ersten Fronteinsatz schwer verwundet. Im Lazarett in Münster pflegte ihn Franziska gesund und verliebte sich in ihn. Um nach der Genesung nicht erneut in den Krieg ziehen zu müssen, wurde Johannes auf dem Bawinkelschen Hof vor der SS versteckt – die ihn als Deserteur erschossen hätte. Auch eine Gefangennahme durch die Rote Armee hätte seinen Tod bedeutet.
Zeitgeschichte und ländliches Leben
Der Roman beginnt im Jahr 1959 und führt über die Jahre des Mauerbaus und -falls, den Zerfall der Sowjetunion bis zu einem Zeitpunkt, an dem Barbara ihr Glück gefunden zu haben scheint. Ein Schicksalsschlag, der Alexa betrifft, stürzt die Familie jedoch in eine Krise. Die Geschichte endet bei der längst erwachsen gewordenen Barbara, wobei die Existenz Pauls vom Autor nicht weiter thematisiert wird.
Im Verlauf der Handlung erfährt der Leser viel über das Leben auf den Höfen im Münsterland, die Tier- und Pflanzenwelt, alte Katasterunterlagen, das Flurbereinigungsgesetz von 1953 und damit verbundene Grenzstreitigkeiten, das Gesetzbuch Code Napoléon von 1804 sowie die Freikaufurkunde. Auch Sitten und Bräuche, bei denen ein Handschlag noch etwas galt, werden thematisiert. Während Dinkel und Emmer aus der Bäckerei bekannt sein dürften, ist Triticale – ein Getreide, das Ludger anbauen möchte – vielen vermutlich neu.
Ein Roman mit Tiefe und historischem Bezug
Mit flüssigem Schreibstil und bestens ausgearbeiteten Figuren, die teilweise reale Vorbilder zu haben scheinen – obwohl alle Personen frei erfunden sind – erinnert Arnold Pesch, selbst Apotheker und damit bestens über die damalige Medikamentenverschreibung informiert, an den „Internationalen Frühschoppen“ von Werner Höfer. Er zitiert wörtlich die Rede von Willy Brandt, dem damaligen Bürgermeister von Berlin, vor dem Schöneberger Rathaus am 16. August 1961, in der dieser den Mauerbau scharf verurteilt – sowie die Antwort von Walter Ulbricht.
Dank sorgfältiger Recherche ist Auf dem Gräftenhof ein informatives Werk über das Leben der „Buern“ im Münsterland – voller Geschichte, Menschlichkeit und ländlicher Kultur.
Auf dem Gräftenhof – Das Vermächtnis von Arnold Pesch
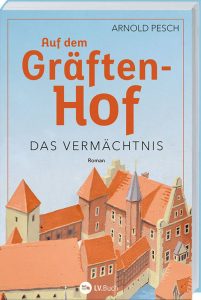
Landwirtschaftsverlag 2025
Klappenbroschur
224 Seiten
ISBN 978-3-7843-5805-5
